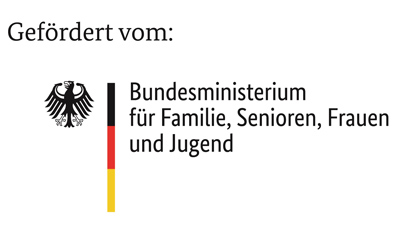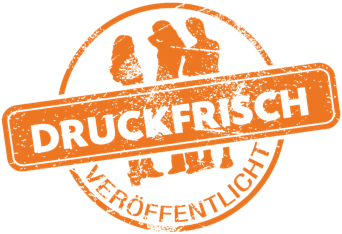In der 31. Dreizehn in Artikel 10 „Wohnungslose junge Menschen – Lebenslagen und Lösungsansätze“ von Martin Kositza, gab es zwei ausfühliche Projektbeispiele sowie einen Exkurs zum „housing first“, die wir im gedruckten Heft kürzen mussten.
Hier können Sie den ganzen Text lesen:
Im Folgenden werden exemplarisch kurz zwei Ansätze vorgestellt, die zwar nicht in Gänze den Forderungen der BAG W entsprechen, aber Anregungen für eine weitere fachliche Auseinandersetzung geben sollen, wie die Wohnungslosigkeit junger Menschen zielführend bekämpft werden kann.
Hildesheimer Übergangsmodell
Das Hildesheimer Übergangsmodell basiert auf einer engen Kooperation von Jungendhilfe und Jobcenter, die Wohnungsnotfallhilfe ist hier also nicht integriert. Das Projekt hat Careleaver im Fokus. Die Rechtkreisübergreifende Zusammenarbeit beinhaltet Kooperationsvereinbarungen, gemeinsame Fallkonferenzen und rechtskreisübergreifende Einschätzungen zum Ende der Hilfe. Sind beim Abschlussgespräch die finanzielle und die Wohnsituation nicht geklärt, wird die stationäre Hilfe verlängert. Nach dem Ende der Hilfe gibt es eine Coming-back-Option für die jungen Menschen. Dabei muss betont werden, dass das Modell entwickelt wurde, bevor die Rückkehroption im KJSG explizit in den Gesetzestext aufgenommen wurde.[1]
Intensivbetreutes Wohnen der Werkstatt Solidarität Essen gGmbH
Die Werkstatt Solidarität Essen mietet Wohnungen an, in denen überwiegend junge Menschen betreut werden, die schon länger in stationären Jugendhilfeeinrichtungen betreut wurden und negative Erfahrungen gemacht haben. Mit Erreichen der Volljährigkeit geht der Mietvertrag auf den jeweiligen Jugendlichen über. Bei Bedarf erfolgt eine Überleitung an das zuständige Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. Bei der Anmietung wird darauf geachtet, dass die Wohnungen den Kriterien der jeweiligen Jobcenter entsprechen.
Die Werkstatt Solidarität ist zudem ein Standort von MOMO – the voice of disconnected youth. MOMO ist eine Gemeinschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aktuell von Obdachlosigkeit betroffen sind oder in der Vergangenheit betroffen waren.[2] Über das Projekt MOMO ist in diesem Heft in der Rubrik „Vor Ort“ zu lesen.
Wenn man also über entsprechende Lösungen nachdenkt, sind für die Jugendhilfe hier in erster Linie Angebote nach § 27 und § 41 SGB VIII in Verbindung mit ambulant betreutem Wohnen oder anderen Wohnformen gefragt. Bei den Bildungsangeboten kommt dann wieder die Jugendsozialarbeit ins Spiel, ebenso im Rahmen des § 13 Abs. 3 SGB VIII bei jungen Menschen, die bereits eine schulische oder berufliche Bildungsmaßnahme absolvieren oder sich in der Phase der beruflichen Eingliederung befinden.
Die Beseitigung von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit junger Menschen ist damit ein Auftrag an die Jugendhilfeplanung, die benötigten Angebote zu schaffen und den gegebenen gesetzlichen Rahmen voll auszuschöpfen. Oberstes Ziel muss es sein, Kinder und Jugendliche ganz im Sinne des SGB VIII vor Gefahren für ihr Wohl schützen. Hierbei sollte mit der Wohnungsnotfallhilfe und den Jobcentern kooperiert und die Aufträge entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen verteilt werden.
Exkurs Housing First
In der Fachdebatte der Jugendhilfe taucht mittlerweile immer wieder das Schlagwort „Housing First“ auf, meist ohne weitere Vertiefung. Mittlerweile gibt es erste Projekte und Projektideen und auch Forderungen auf politischer Ebene.[3]
Wenn man ein wenig mehr über diesen Ansatz wissen will, lohnt sich ein Blick auf die europäische Ebene, denn hier gibt es mit Housing First for Youth (HF4Y) im Rahmen von Housing First Europe bzw. dem Housing First Hub eine Vernetzungs-, Wissens- und Weiterbildungsplattform. Die dort vorgestellten Kernprinzipien des Housing-First-Ansatzes für junge Menschen sind:
- Unmittelbarer Zugang zu Wohnraum ohne Vorbedingungen
- Wahlfreiheit und Selbstbestimmung der Jugendlichen
- Orientierung an einer positiven Entwicklung des Jugendlichen
- Individuelle, klient*innenorientierte Betreuung ohne zeitliche Begrenzung
- Soziale und gesellschaftliche Integration
Im Grundsatzpapier heißt es zudem: „Housing First for Youth (HF4Y) ist eine auf Rechten basierende Intervention für junge Menschen (im Alter von 13 bis 24 Jahren), die von Wohnungslosigkeit betroffen oder gefährdet sind, wohnungslos zu werden. Sie ist darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Entwicklungsphase zu erfüllen, indem sie ihnen schnellen Zugang zu einer sicheren, erschwinglichen und angemessenen Wohnung ohne Vorbedingungen verschafft und dies mit notwendiger und altersgerechter Unterstützung, die sich auf Gesundheit, Wohlbefinden, Lebenskompetenzen, Engagement in Bildung und Beschäftigung sowie soziale Integration konzentriert.“ (Housing First Hub 2023, S. 3)
Zusammengenommen ist dieser Ansatz im europäischen Kontext mancherorts ein Quantensprung. Im deutschen Hilfesystem sollte er aber vor allem einen Gedanken auslösen, und zwar „das ist Jugendhilfe“ oder besser gesagt „das sollte Jugendhilfe können!“. Die Housing-First-Idee kann also genutzt werden, um zu diskutieren, wie niedrigschwellige Angebote geschaffen werden können, die junge Menschen erreichen, die in anderen stationären Hilfen „gescheitert“ sind. Positiv hervorzuheben ist vor allen Dingen der rechtsbasierte Ansatz, der sich auf das Recht auf Wohnen bezieht, und der bedingungslose Zugang zu Wohnraum. Dieser könnte helfen, das Grundrecht auf Wohnen sozialpolitisch und in der Arbeit mit den jungen Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Eine weitere positive Besonderheit des Ansatzes ist es, dass die Betreuung keiner zeitlichen Begrenzung unterliegen soll. Dies hört sich erst einmal schwierig an, wenn man an die Jugendhilfe denkt, widerspricht aber im Prinzip nicht dem rechtlichen Rahmen im SGB VIII. Denn keine zeitliche Begrenzung heißt ja nur, dass die Unterstützung so lange erfolgt, wie ein Hilfebedarf besteht. Dies ist im SGB VIII durchaus vorgesehen, solange die Altersgrenzen berücksichtigt werden.
Die einzige Alternative zur Nutzung der bestehenden rechtlichen Strukturen wäre eine Projektfinanzierung. Doch ist dies wirklich ein guter Weg?
In der Wohnungslosenhilfe wurde Housing First bisher im Rahmen von Projekten realisiert, mittlerweile gibt es aber eine Fachdiskussion und mancherorts Bemühungen, Housing First in das Hilfeangebot nach §§ 67 ff. SGB XII zu integrieren.
Die Befürworter*innen einer Projektfinanzierung verweisen häufig darauf, dass Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII schwierig durchzusetzen seien. Gleiches trifft sicherlich auch auf Hilfen nach dem SGB VIII zu. Aus Sicht der BAG W ist die Durchsetzung bestehender Rechtsansprüche aber nahezu alternativlos, wenn Hilfeformen im Regelsystem verstätigt werden sollen. Die Projektfinanzierung befreit zwar im ersten Moment von der lästigen Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Träger, dennoch ist sie ein Pyrrhussieg. Denn mit der Projektfinanzierung tauscht man in der Regel den ermessensfreien Rechtsanspruch gegen eine Finanzierung, die hochgradig vom politischen Willen abhängig ist und schon nach der nächsten Wahl obsolet sein kann. Ein Bundesgesetz hingegen lässt sich nicht so leicht ändern.
Die Frage nach einer Regelfinanzierung sollte folglich von Beginn an im Fokus stehen, wenn in der Jugendhilfe über Housing First nachgedacht wird. Der rechtliche Rahmen der Jugendhilfe bietet schon jetzt die Möglichkeit, niedrigschwellige Angebote für junge Menschen im Bereich Wohnen zu realisieren. Grundlage dafür sind die § 27 und § 41 SGB VIII in Verbindung mit Hilfen für betreutes bzw. ambulant betreutes Wohnen. Inkludiert ist dabei ein sicherer Rechtsanspruch, ganz im Sinne des rechtebasierenden Ansatzes von Housing First for Youth.
Hilfen, die sich daran orientieren, dass für die jungen Menschen am Ende ein eigener Wohnraum zur Verfügung steht, sollten in der Jugendhilfe in jedem Fall stärker in den Fokus rücken. Angebote, die sich an Housing First orientieren, könnten dabei ein Baustein sein.
[1] Das Hildesheimer Übergangsmodell ist unter https://forschungsnetzwerk-erziehungshilfen.de/wp-content/uploads/2020/08/Feyer_Uebergangsmodell.pdf (24.02.2024) abrufbar.
[2] Weiterführende Informationen unter: https://www.werkstatt-solidaritaet-essen.de/
[3] Siehe den Antrag der Linken „Zuerst ein Dach über dem Kopf – Neue Perspektiven für Straßenkinder und wohnungslose junge Menschen eröffnen“, Drucksache 19/24642 unter https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924642.pdf (23.02.2024).