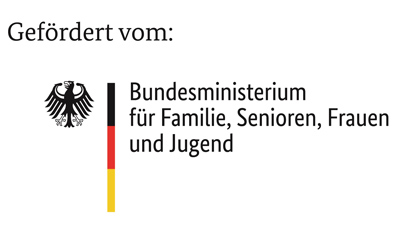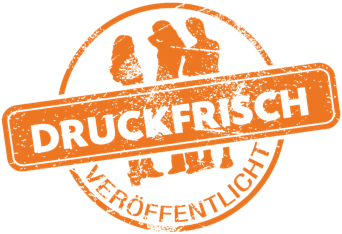Mit einer Umfrage zum Startchancen-Programm zeigt der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, dass die Fachkräfte der Jugendsozialarbeit großen Gestaltungswillen im Programm haben. Zugleich äußern sie Enttäuschung in der Umsetzung und bei den Perspektiven. Erwartet werden verlässliche Rahmenbedingungen und ein Ernstnehmen der Profession Jugendsozialarbeit.
Die Umfrageergebnisse zeigen es sehr deutlich: Die Jugendsozialarbeit möchte gerne mitgestalten, hat konkrete Ideen, bringt Angebote ein, fühlt sich jedoch ausgebremst. Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit erfasste im Rahmen einer bundesweiten Befragung von Fachkräften der Sozialen Arbeit zum Start des zweiten Programmjahrs (Schuljahr 2025/2026) erste Erfahrungen, Einschätzungen und Herausforderungen bei der Umsetzung des Startchancen-Programms. Das Programm von Bund und Ländern zielt darauf, Bildungsungleichheiten abzubauen und jungen Menschen bessere Entwicklungschancen zu ermöglichen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Grundidee des Programms einhellig begrüßt, jedoch die Umsetzung kritisiert wird. So schreibt ein:e Teilnehmer:in in der Umfrage: „Die Grundidee war generell gut, aber wie so oft leider nicht mit den Konsequenzen bedacht.“ Die Fachkräfte zeigen großes Engagement, indem sie sich mit sozialpädagogischen Angeboten in das Programm einbringen. Gleichzeitig beschreiben die Fachkräfte Hürden wie unsichere, nicht ausreichende Finanzierungen, bürokratische Aufwände, mangelnde Transparenz und eine unzureichende Einbindung der (freien) Träger der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch der Fachkräfte der Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Notwendig sind demnach eine systematische Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe und freien Trägern sowie bessere Rahmenbedingungen für nachhaltige und wirkungsvolle Ergebnisse. Nur so können die ambitionierten Ziele des Programms erfüllt und langfristig bessere Startchancen für alle jungen Menschen geschaffen werden.
1. Programm-Kontext und Hintergrund der Umfrage
Mit dem Startchancen-Programm haben Bund und Länder im Jahr 2024 eine bildungspolitische Initiative auf den Weg gebracht. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen insgesamt 20 Milliarden Euro investiert werden, um Schulen mit einem hohen Anteil sog. sozial benachteiligter Schüler*innen gezielt zu unterstützen. Ziel ist es, ungleiche Bildungschancen zu verringern und jungen Menschen bessere Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Seit dem Schuljahr 2024/25 erhalten die Startchancen-Schulen Förderung in den Säulen „Investitionen in die Schulinfrastruktur“ (Programmsäule I), „Chancenbudgets für die Schul- und Unterrichtsentwicklung“ (Programmsäule II) sowie „Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams“ (Programmsäule III). Im zweiten Programmjahr werden aktuell fast zehn Prozent der Schulen in Deutschland über das Startchancen-Programm gefördert, rund 4.000 Schulen.
Für die Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) und Schulsozialarbeit (§13a SGB VIII) eröffnen sich in den Programmsäulen II und III Beteiligungsoptionen. Sie verfügen über langjährige Expertise in der Begleitung junger Menschen, in der Förderung sozialer Teilhabe und in der Kooperation mit Schulen. Gleichzeitig stellen sich zahlreiche Fragen:
Wie werden die Angebote der Jugendsozialarbeit und die Schulsozialarbeit konkret in das Programm eingebunden? Welche Rahmenbedingungen fördern oder verhindern eine zielführende Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe? Und welche Herausforderungen zeigen sich aus Sicht der Praxis?
Um Antworten auf diese Fragen zu gewinnen, führte der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit zum Beginn des Schuljahres 2025/26 eine bundesweite Befragung unter seinen Mitgliedsverbänden durch.
2. Ergebnisse der Umfrage
2.1. Durchführung und Teilnehmende
Die Umfrage richtete sich an Träger und Fachkräfte aus der (schulbezogenen) Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Ziel war es, einen Überblick über die Beteiligung an Programm-Schulen, Erfahrungen und Einschätzungen der Fachkräfte und ihrer Träger im Kontext des Programms zu gewinnen.
Insgesamt nahmen 109 Personen aus fast allen Bundesländern teil, lediglich aus Bremen gab es keine Rückmeldungen.
Struktur der Teilnehmenden
- 62,4 % der Befragten sind an Schulen tätig, die bereits im Startchancen-Programm gefördert werden.
- 32 % arbeiten an Grundschulen, 29,7 % an weiterführenden Schulen, weitere Rückmeldungen stammen aus beruflichen Schulen und Förderschulen.
- 76,5 % der Befragten arbeiten an oder kooperieren mit öffentlichen Schulen.
- Fast die Hälfte (46 %) der Befragten setzt klassische Schulsozialarbeit oder Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) um, 16,5 % bieten sozialpädagogische Angebote wie Präventionsprojekte oder Hilfen für schulabsente junge Menschen an.
- 45,2 % der Fachkräfte verfügen über mehr als elf Jahre Erfahrung in der Kooperation mit „ihrer“ Schule, beinahe alle weiteren Teilnehmer:innen sind bereits mehrjährig an den Schulen tätig, also bereits vor Programmstart.
- Die Rückmeldungen kamen weit überwiegend aus städtischen Räumen.
2.2. Erkenntnisse zu geplanten Programminhalten und Anliegen der Fachkräfte
Die Rückmeldungen zeigen, dass bisherige Planungen zur Programmumsetzung vor allem die Aufstockung von Schulsozialarbeit sowie erweiterte Angebote zum Sozialen Lernen umfassen. Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass Schulen noch in der Planungsphase sind und das konkrete Vorgehen noch nicht absehbar ist. Die Teilnehmer:innen geben insgesamt eine grundsätzlich kritische Einschätzung zur bisherigen Umsetzung ab.
Aufstockung der Schulsozialarbeit
Zur Aufstockung der Schulsozialarbeit berichten einige Fachkräfte, dass trotz der Absichten und Mittel im Startchancen-Programm keine Stellen bei freien Trägern aufgestockt werden können, selbst wenn sie bereits an Startchancen-Schulen tätig sind. Gründe sind unzureichende finanzielle Ausstattung, Befristung der Verträge auf ein Schuljahr oder unklare zeitliche Perspektive und geforderte Vorfinanzierung. Das erschwert ein nachhaltiges Angebot und Personalplanung. Andere Fachkräfte berichten von konkreten geplanten oder bereits erfolgten Aufstockungen um 0,5 bis 1 Vollzeitstelle. Die Unterschiede zeigen sich insbesondere zwischen den Bundesländern, seltener innerhalb eines Bundeslandes.
Soziales Lernen und Stärkung von Ganztag und multiprofessionellen Teams
Wegen der weiterhin andauernden Planungsphase ist oft noch unklar, ob und wie sich eine Zusammenarbeit der Jugendsozialarbeit mit den Startchancen-Schulen gestalten wird. Neben Schulsozialarbeit werden Sozialkompetenztrainings genannt, Präventionsprojekte, Gruppenangebote für Klassen sowie die Stärkung von Partizipation der jungen Menschen bei Gestaltung von Schule als ihren Lebensraum und Workshops mit Sozialraumbezug. Zur Erweiterung des Ganztagsangebots werden Möglichkeiten gesehen durch externe Fachkräfte für Demokratiebildung, Kommunikationstrainings oder Gewaltprävention. Der Wunsch nach nachhaltiger Vernetzung schulischer und sozialpädagogischer Akteure und die Stärkung der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams werden mehrfach betont.
Grundsätzliche Programmkritik
In den Rückmeldungen der Umfrage-Teilnehmer:innen wird deutlich, dass Träger und Fachkräfte auf verschiedenen Ebenen (noch?) nicht ausreichend eingebunden sind. Die vom Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit bereits 2023 geforderte Beteiligung der Kinder- und Jugendhilfe wurde nicht realisiert. Die prekäre Finanzierung, die Befristung der Verträge und die fehlende Dynamisierung der Mittel verhindern die notwendige Planungssicherheit.
Empfehlungen des Kooperationsverbundes
Die Kommunikation zwischen Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene erleben die Beteiligten generell als unzureichend, ebenso den Informationsfluss an die Schulen und beteiligten Akteure. Die Fachkräfte kritisieren die Intransparenz, unzureichende Informationen und hohe bürokratische Anforderungen sowie die sehr unterschiedliche konzeptionelle Ausgestaltung in den Bundesländern. Sie fordern daher klare Strukturen, bessere Abstimmung mit allen Akteuren und langfristige, verlässliche Finanzierung.
3. Bewertung des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit
Obwohl die Träger und Fachkräfte sehr engagiert sind, um die Bildungs- und Teilhabechancen sog. benachteiligter junger Menschen durch verstärkte Schulsozialarbeit und ergänzende Angebote nachhaltig zu verbessern, wird die Umsetzung durch erhebliche strukturelle und administrative Hürden erschwert. So ist die Einbindung der Jugendsozialarbeit und freier Träger in die Programmgestaltung unzureichend. Um die vorhandenen Programmpotenziale nutzen zu können, ist eine systematische Vernetzung zwischen den Akteuren von Schule und Kinder- und Jugendhilfe auf allen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) notwendig.
Die ursprüngliche bildungspolitische Euphorie über das Startchancen-Programm ist mittlerweile gedämpft. Die sehr heterogene Herangehensweise in den Bundesländern, die Intransparenz sowohl bezüglich der Inhalte als auch der Verfahren und die prekäre Finanzierung behindern Beteiligung und Innovationen.
Damit das Startchancen-Programm sein Versprechen, die Chancengleichheit im Bildungssystem zu verbessern, einlösen kann, braucht es dringend den Abbau der bürokratischen Hürden, Transparenz über die Förderinhalte und die Verfahren. Nachhaltige Finanzierungsmodelle, ein guter Informationsfluss, zielführende Koordinationsstrukturen sowie eine echte Kooperation zwischen Schule, Jugendhilfe und freien Trägern sind ebenso wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg.
4. Fazit und Ausblick
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass im Startchancen-Programm eine wertvolle Chance liegt, mit zusätzlichen Ressourcen gezielt sozialpädagogische Begleitung und präventive Angebote an und mit den Schulen auszubauen, gleichzeitig belegen sie erhebliche Umsetzungshindernisse. Die Grundidee des Startchancen-Programms wird in der Praxis getragen und, wo möglich, mit großem Engagement umgesetzt. Nun gilt es, die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass dieser Gestaltungswille nachhaltig Früchte trägt, damit die jungen Menschen tatsächlich bessere Startchancen erhalten.
Die langjährigen Erfahrungen und die hohe Fachlichkeit von Jugend- und Schulsozialarbeit an den Startchancen-Schulen müssen besser genutzt, Doppelstrukturen vermieden und die Praxisexpertise stärker in die Programmgestaltung einbezogen werden.
Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit wird die weitere Programmumsetzung bundesweit begleiten. Er wird dafür mit Akteuren der Jugendsozialarbeit in den Bundesländern im Dialog bleiben, den Informationstransfer unterstützen, die Anliegen und Erfahrungen von Fachkräften und Trägern bündeln und in den Austausch mit den Programmbeteiligten auf Bundesebene treten. Erste Kommunikationsformate werden derzeit z.B. im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung etabliert. Hier setzt er sich für eine stärkere Anerkennung und Einbindung der Jugendsozialarbeit in die konzeptionelle Weiterentwicklung ein, um eine bedarfsgerechte und nachhaltige Programmumsetzung zu unterstützen.
Der weitere Erfolg des Startchancen-Programms hängt maßgeblich davon ab, wie schnell und verlässlich die genannten Hürden abgebaut werden und wie es mit vereinten Kräften gelingt, eine systematische Zusammenarbeit zu etablieren.
Autorinnen und Ansprechpartnerinnen:
Julia Schad-Heim, IN VIA Deutschland im Netzwerk der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS)
Claudia Seibold, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA)