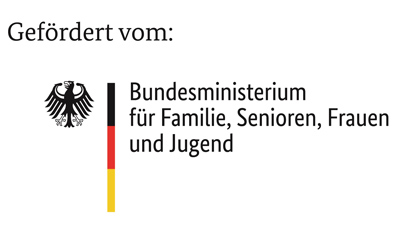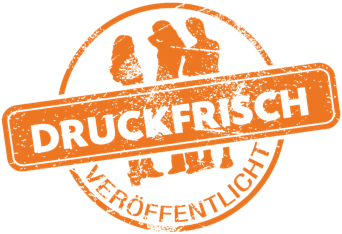Mit der Stellungnahme „Zur Zukunft von Erasmus+ und ESK ab 2028 mit Fokus auf Jugendsozialarbeit“ reagiert der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit auf die Pläne der EU-Kommission, den Mittelfristigen Finanzrahmen (MFR) der EU stark zu verändern. In der Stellungnahme betont der Kooperationsverbund die Bedeutung der Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps (ESK).
Die Jugendsozialarbeit spielt eine zentrale Rolle bei der Begleitung und Förderung junger Menschen mit geringeren Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Für diese Zielgruppen – insbesondere wirtschaftlich, sozial oder bildungsbezogen benachteiligte junge Menschen, NEETs (Not in Education, Employment or Training), junge Migrant*innen und Geflüchtete – bietet Erasmus+ außerordentliche Chancen, internationale Lernerfahrungen zu sammeln, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und neue Perspektiven für ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu gewinnen.
Mit dem Vorschlag der EU-Kommission zur neuen Programmgeneration Erasmus+ 2028–2034 werden wesentliche Weichen für die Zukunft der europäischen Jugend- und Bildungsprogramme gestellt. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit sind viele der geplanten Entwicklungen positiv zu bewerten – gleichzeitig bestehen an entscheidenden Stellen noch Nachbesserungsbedarfe.
1. Eigenständiger Jugendbereich mit gesichertem Budgetanteil
Positiv ist, dass der Jugendbereich im neuen Erasmus+-Vorschlag als eigenes Handlungsfeld bestehen bleibt. Damit wird die Bedeutung von Jugend, Inklusion und demokratischer Teilhabe in Europa erneut unterstrichen.
Allerdings ist bislang offen, welcher Anteil des Gesamtbudgets (voraussichtlich 40,8 Mrd. Euro) auf den Jugendbereich entfällt. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit muss ein verbindlicher Mindestanteil von 15 bis 20 Prozent festgelegt werden, um die Gleichwertigkeit mit anderen Bildungsbereichen sicherzustellen und eine strukturelle Unterfinanzierung zu vermeiden.
Eine feste Budgetquote für Erasmus+ verhindert, dass Projekte für junge Menschen mit geringeren Chancen aufgrund einer Überzeichnung des Programms nicht gefördert werden können. Sie würde sicherstellen, dass Erasmus+ auch zukünftig die Teilhabe junger Menschen fördert.
2. Zwei programmatische Ziele: Skills und Demokratie
Die Setzung der beiden Hauptziele „Skills“ und „Demokratie“ ist zu begrüßen. Erasmus+ trägt wesentlich zur Förderung beruflicher, sozialer und demokratischer Kompetenzen bei. Wichtig ist jedoch, dass die Förderung der Demokratiebildung und der gesellschaftlichen Teilhabe gleichrangig mit der Entwicklung von arbeitsmarktrelevanten Kompetenzen behandelt wird.
Die Jugendsozialarbeit unterstützt, dass das Programm weiterhin non-formale Bildung, politische Bildung und die Stärkung einer europäischen Identität fördert.
3. Verhältnis Bildung – Jugend: Gleichgewicht sichern
In der weiteren Programmausgestaltung darf keine strukturelle Konkurrenz zwischen den Bereichen Bildung und Jugend entstehen. Es besteht die Gefahr, dass der stärker auf Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtete Bildungsbereich die jugendspezifischen Anliegen überlagert. Die EU-Kommission wird daher aufgefordert, eine klare jugendpolitische Profilierung sicherzustellen, die über reine Qualifizierung hinausgeht.
4. Inklusion und Teilhabe als Querschnittsthema
Begrüßenswert ist das geplante eigene Kapitel zu Inklusion. Es stärkt die Aufmerksamkeit für benachteiligte Gruppen und die soziale Dimension des Programms. Gleichzeitig sollten andere gesellschaftliche Themen – wie Umwelt, Partizipation oder Digitalisierung – weiterhin berücksichtigt bleiben und nicht in den Hintergrund treten.
5. Europäische Jugendarbeitsagenda und EU-Jugendstrategie integrieren
Das neue Programm erkennt die Europäische Jugendarbeitsagenda („European Youth Work Agenda“) bereits als Leitdokument an. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit ist es jedoch notwendig, auch die EU-Jugendstrategie stärker in die Ziele, Indikatoren und Förderlogiken von Erasmus+ zu integrieren. Nur durch eine engere Verzahnung zwischen EU-Jugendstrategie und Förderpolitik kann die europäische Jugendpolitik kohärent umgesetzt werden.
6. Drittstaaten und internationale Zusammenarbeit
Positiv ist, dass künftig auch Drittstaaten gezielt am Programm teilnehmen können. Internationale Kooperationen fördern interkulturelles Lernen und tragen zur globalen Verantwortung Europas bei. Allerdings sollte es Voraussetzung sein, dass eine Teilnahme an Erasmus+ nur möglich ist, wenn alle Programmsektoren und nicht etwa einzelne, ausgewählte Bereiche (z. B. Hochschulbildung) umgesetzt werden.
7. Europäisches Solidaritätskorps (ESK) – klare Profilierung beibehalten
Die geplante Integration des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) in Erasmus+ Jugend wird grundsätzlich unterstützt. Entscheidend ist jedoch, dass die Freiwilligendienste weiterhin als eigenständiges, klar erkennbares Handlungsfeld sichtbar bleiben. In der Bezeichnung sollte ausdrücklich das Element des „Freiwilligendienstes“ enthalten sein (z. B. „Volunteer“ bzw. „Freiwillig“), um das Engagement- und Solidaritätsprinzip zu betonen. Eine zukünftige Zusammenführung der beiden Programme Erasmus+ und ESK, darf nicht zu einer Budgetreduzierung führen.
8. Synergien mit ESF+ und beruflicher Bildung
Die stärkere Verzahnung von Erasmus+ mit dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) bietet Potenzial, um junge Menschen mit geringeren Chancen besser zu erreichen. Beide Programme sollten sich ergänzen und insbesondere Übergänge zwischen Bildung, Beschäftigung und gesellschaftlicher Teilhabe erleichtern. Dabei muss gewährleistet sein, dass der Jugendbereich und der berufliche Bereich im ESF+ wie auch in Erasmus+ strukturell gestärkt und finanziell abgesichert werden.
9. Bedeutung der non-formalen Bildung und Soft Skills
Erasmus+ trägt wesentlich zur Entwicklung sozialer Kompetenzen, Selbstwirksamkeit und gesellschaftlicher Verantwortung junger Menschen bei. Die Förderung non-formaler und informeller Lernprozesse muss weiterhin einen hohen Stellenwert behalten. Eine zu starke arbeitsmarktpolitische Ausrichtung würde den Charakter des Programms schwächen und die Wirksamkeit für die Zielgruppen der Jugendsozialarbeit einschränken.
10. Jugendbeteiligung und niedrigschwellige Formate
Die Beteiligung junger Menschen – insbesondere der Zielgruppen der Jugendsozialarbeit und deren Trägern – an der Programmumsetzung muss systematisch ausgebaut werden. Niedrigschwellige Formate wie Kleine Partnerschaften/Small-Scale-Projects und Mikroprojekte/Micro-Grants sind dafür unverzichtbar. Sie ermöglichen es, auch kleineren Trägern ohne große Verwaltungskapazitäten eine Teilnahme zu sichern. Zivilgesellschaftliche Beteiligungsformate auf der Programmebene, z.B. der Jugendbeirat Erasmus+/ESK bei der nationalen Agentur Jugend für Europa in Deutschland, müssen auch für benachteiligte Zielgruppen zugänglich sein.
Schlussfolgerung
Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps bleiben zentrale Instrumente zur Förderung von Demokratie, sozialem Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit in Europa. Die Vorschläge der EU-Kommission zur neuen Programmgeneration sind ein starkes Signal für Jugend, Inklusion und Partizipation.
Für die Jugendsozialarbeit ist jedoch entscheidend, dass der Jugendbereich finanziell abgesichert, die EU-Jugendstrategie systematisch integriert, die non-formale Bildung gleichwertig berücksichtigt und die Beteiligung benachteiligter Jugendlicher aktiv gefördert wird.
Nur so kann Erasmus+ ab 2028 sein volles Potenzial entfalten – als Programm, das alle jungen Menschen in Europa erreicht und stärkt.